Dieser Artikel erklärt, was Innenarchitektur ausmacht und warum sie ein entschiedener Faktor für die Qualität unserer gebauten Umgebung ist. Von sachlichen Fakten des Berufsfeldes, über das Wirkungsfeld zwischen Wahrnehmung, Psychologie und Kreativität und den Zauber der dadurch für Räume entstehen kann.
Einführung in die Innenarchitektur
Tätigkeitsfeld
Der Berufsverband der Innenarchitekt*innen (bdia) beschreibt das Tätigkeitsfeld so:
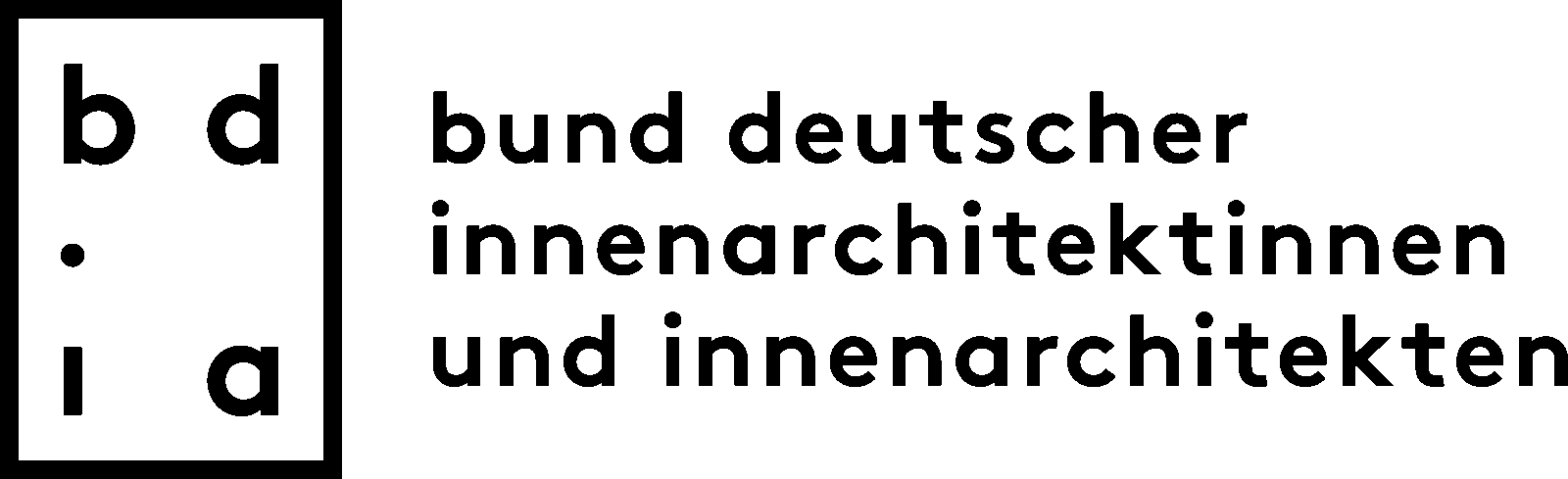
Innenarchitekt*innen sind Fachleute
https://bdia.de/fuer-absolventen-studenten/taetigkeitsfelder-innenarchitektur/
für das Innere von bestehenden oder neu zu planenden Gebäuden,
für die mit der Planung von Innenräumen in Zusammenhang stehenden baulichen Änderungen von Gebäuden,
für die innere Funktion, Konstruktion, Ästhetik und Atmosphäre von Objekten,
für das physische, psychische und soziale Wohlbefinden des Menschen.
Innenarchitektur vs. Interior Design, Architektur, Raumausstattung
Die Begriffe Innenarchitektur und Interior Design werden im Alltag oft synonym verwendet – dabei unterscheiden sie sich deutlich in Anspruch, Aufgabenfeld und rechtlicher Definition. Wie steht INNENarchitektur zur Architektur und womit beschäftigen sich die Raumausstatter?
Innenarchitektur
umfasst die bauliche und konzeptionelle Gestaltung von Innenräumen. Sie greift in die Raumstruktur ein, berücksichtigt technische Anforderungen, entwickelt funktionale Abläufe, entwirft individuelle Möbel und gestaltet die Atmosphäre. Anhand von Entwurfszeichnungen, Moodboards und technischen Ausführungsplänen wird die Maßnahme entwickelt, dargestellt und die Details für die ausführenden Gewerke festgelegt. Es werden Ausschreibungen erstellt, und anhand der Angebote die geeigneten Firmen zur Ausführung ausgewählt und beauftragt. Die Umsetzung wird koordiniert und überwacht.
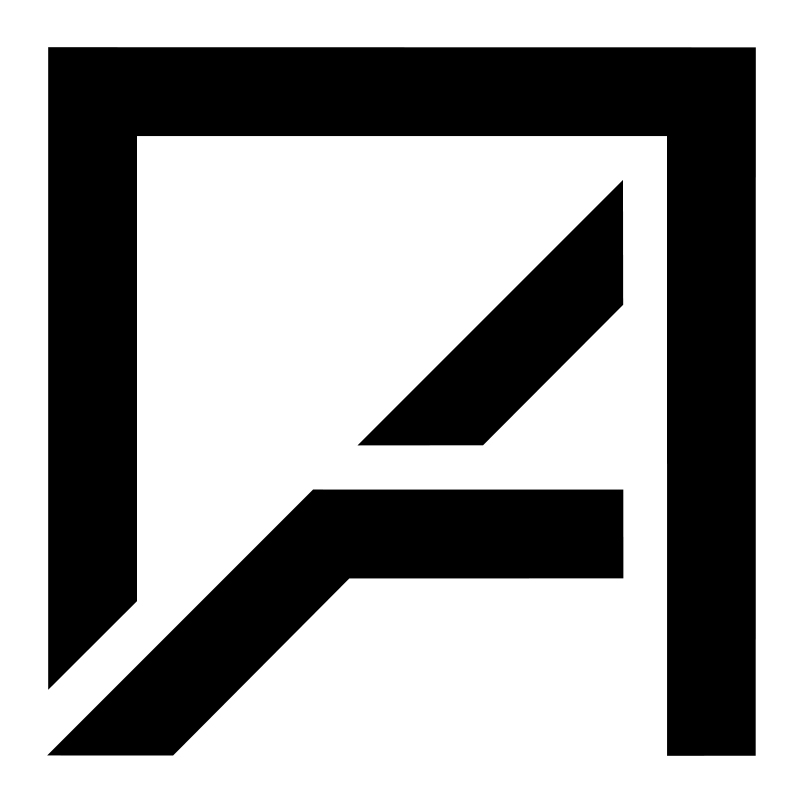
Die Berufsbezeichnung Innenarchitekt / Innenarchitektin ist rechtlich geschützt und darf in Deutschland nur führen, wer in der Architektenliste der Länderarchitektenkammern eingetragen ist. Dies setzt in der Regel ein abgeschlossenes Studium der Innenarchitektur und eine anschließende Berufspraxis von mindestens zwei Jahren voraus.
Interior Design
konzentriert sich auf die ästhetische und stilistische Gestaltung von Räumen. Dazu gehören das erstellen von Farbkonzepten, Möblierung, Dekoration und Ausstattung. Interior Designer greifen nicht in die Bausubstanz ein und arbeiten in den gegebenen Strukturen.
Der Begriff Interior Designer ist nicht geschützt und kann von Jedem als Berufsbezeichnung genutzt werden.
Architektur
befasst sich mit der Planung und Gestaltung von Gebäuden: von der äußeren Hülle über die Statik bis zur technischen Gebäudeausstattung. Vom Entwurf, der Genehmigungsplanung, der Integration der technischen Ausbaugewerbe durch Fachplaner bis zur Bauleitung und Abrechnung eines Bauvorhabens. Die Innenarchitektur in diesem Rahmen als Fachplaner für die Innenraumgestaltung zu betrachten.
Die Berufsbezeichnung Architekt / Architektin ist genauso rechtlich geschützt wie der, des Innenarchitekten / der Innenarchitektin.
Raumausstattung
bezeichnet einen handwerklichen Ausbildungsberuf zur Raumausstatterin und Raumausstatter, der sich auf die praktische Umsetzung von Raumgestaltung konzentriert. Sie beraten und verarbeiten Bodenbelägen, Wandbelägen, Gardinen, Bezugsstoffen und Accessoires und erreichen so eine funktionale und ästhetische Ausstattung von Räumen.

Kissen-Knicker
Die Bezeichnung Kissen-Knicker, die oft abwertend und provokant die Tätigkeit der Innenarchitekt*innen zusammenfasst, ist immer ein Aufreger. Das Bild, dass jemand etwas rumrüschelt, hier und da noch etwas zurechtrückt und am Ende den krönenden Abschluss einer Raumgestaltung erreicht, in dem er den Kissen auf dem Sofa mit dem Handkantenschlag den Knick versetzt.
Historische Entwicklung der Innenarchitektur
Ein kurzer Überblick auf die Epochen:
• Antike Kulturen (Ägypten, Griechenland, Rom):
Erste bewusste Gestaltung von Innenräumen mit Säulen, Wandmalereien und Möbeln als Ausdruck von Status und Ästhetik.
• Mittelalter:
Funktionale und symbolisch geprägte Innenräume in Burgen und Sakralbauten, oft mit schwerem Mobiliar und religiöser Ornamentik.
• Renaissance:
Wiederentdeckung von Proportion, Licht und Harmonie. Innenräume wurden kunstvoll und humanistisch gestaltet.
• Barock und Rokoko:
Opulente Raumgestaltung mit aufwendigen Dekorationen, Spiegeln und verspielten Details – Ausdruck von Macht und Repräsentation.
• 19. Jahrhundert / Industrialisierung:
Technischer Fortschritt und neue Materialien führten zu funktionalen Raumkonzepten und ersten Ansätzen moderner Innenarchitektur.
• 20. Jahrhundert / Moderne & Bauhaus:
Innenarchitektur wird zur eigenständigen Disziplin. Fokus auf Funktionalität, Klarheit und das Zusammenspiel von Raum, Mensch und Material.
• Heute:
Ganzheitlicher Ansatz, der Ästhetik, Nachhaltigkeit, Technik und Psychologie vereint. Innenarchitektur schafft Räume, die erlebt und gefühlt werden.

Tätigkeitsbereiche und Themen der Innenarchitektur
Diese Auflistung stammt von der Seite des BDIA unter der Rubrik Berufsbild der Innenarchitektur.
Planerische Tätigkeiten
Die planerischen Tätigkeitsbereiche sind sehr vielseitig und anspruchsvoll.
Innenarchitekt*innen befassen sich mit:
- Ausstellungsbauten
(z.B. Kommunikation im Raum: Messestände, Ausstellungsgestaltungen für Firmen und Museen) - Betreuungs-, Pflegebauten und Bauten für das Gesundheitswesen
(z.B. barrierefreiem und altersgerechtem Bauen für Senioren, Menschen mit Behinderungen und Kinder, Empfangs- und Aufenthaltsbereiche, Patientenzimmer in Heimen, Tagesstätten und Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen, Reha-/Therapiezentren) - Design
(z.B. individuellen Möblierungen, Möbel und Einbauten, Produktdesign, Leuchtendesign und Lichtplanungen) - Freizeit- und Erholungsbauten
(z.B. Kureinrichtungen, Freizeitparkbauten, Sportstätten, Schwimmbäder, Saunen und Wellnessbereiche) - Handelsbauten
(z.B. individueller Ladenbau, Shopdesign, Fachgeschäfte und Sonderbereiche in Einkaufsmalls) - Hotel- und Gastronomiebauten
(z. B. Empfangs- und Erschließungsbereiche, Gastronomien, Küchen und Zimmer von Hotels, Spa-Bereiche, Restaurants und Bars, Casinos) - Kulturbauten
(z.B. Versammlungsstätten, Empfangs- und Erschließungsbereiche, Theater, Kino- und Konzertsäle, Bühnenbilder, Andachts- und Kirchenräume) - Sakralbauten
(z.B. Aussegnungsstätten) - Schulungs- und Forschungsbauten
(z.B. Foyers, Erschließungsbereiche, Klassenzimmer, Bibliotheken, Mensen und Küchen von Schulen, Akademien, Instituten, Hochschulen und Laboren) - Verwaltungsbauten und Verkehrsbauten
(z.B. Eingangs- und Empfangsbereiche, Büros, Arbeitsplatzgestaltungen, Konferenz- und Schulungsräume, Betriebsgastronomien von Büro-, Verwaltungsgebäuden und Banken) - Verkehr
(z.B. Innenraumgestaltung von Kreuzfahrtschiffen und Yachten, Flugzeugen, Bahnwagons und Wohnwagen, Bereiche in Verkehrsbauten wie Bahnhöfen, Flughafengebäuden) - Wohnungsbau
(z.B. Umbau und Modernisierungen von Einfamilienhäusern und Geschosswohnungsbauten, individuellen Küchen, Bäder- und Möblierungsplanungen, Wohn- Schlaf- und Wellnessbereiche)
Dienstleistungen
Weitere Dienstleistungen erweitern und ergänzen oft die planerische Tätigkeit der Innenarchitekt*innen:
- Beratende Tätigkeiten (u.a. Wohn- und Arbeitsplatzberatung, Wettbewerbsberatung, Projektsteuerung, Ökologische und Baubiologische Beratung, Feng Shui Beratung, Geomantie)
- Denkmalpflege (u.a. Bestandserfassungen, Nutzungskonzeptionen unter denkmalpflegerischen Aspekten)
- Fachplanungstätigkeiten (u.a. Licht- und Akustikplanung)
- Barrierefreies Planen
- FM (Facility Management)
- Gebäudemanagement während der Nutzungsphase eines Gebäudes
- Kommunikationstätigkeiten (u.a. journalistische Tätigkeit, Seminar- und Vortragstätigkeiten)
- Machbarkeitsstudien vor Beginn der Planungsphase
- Sachverständigentätigkeit, staatliche anerkannte Sachverständige, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
- SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator)
- Visualisierungen (u.a. Modellbau, 3D-Animationen, Fotografie)
- Forschungs- und Lehrtätigkeiten
Aufgaben und Ziele der Innenarchitektur
Die Innenarchitektur verfolgt das Ziel, Räume zu schaffen, die funktionieren, wirken und berühren. Sie verbindet technische Planung mit gestalterischer Präzision und stellt den Menschen in den Mittelpunkt jeder räumlichen Entscheidung.
Aufgaben
• Raumanalyse und Bedarfsermittlung
Erkennen von funktionalen Anforderungen, Nutzerbedürfnissen und räumlichen Potenzialen.
• Konzeption, Entwurf und Planung
Entwicklung von Raumstrukturen, Funktionsabläufen, Farb- und Materialkonzepten, Möblierung
• Gestaltung von Atmosphäre und Identität
Einsatz von Farbe, Licht, Akustik und Oberflächen zur emotionalen Raumwirkung und Schaffung einer Identität
• Integration technischer Anforderungen
Berücksichtigung von Brandschutz, Barrierefreiheit, Haustechnik.
• Koordination und Umsetzung
Abstimmung mit Fachplaner:innen, Handwerksbetrieben und Projektbeteiligten.
• Qualitätskontrolle und Bauleitung
Sicherstellung der gestalterischen und technischen Umsetzung vor Ort.
Ziele
• Funktionale Effizienz
Räume sollen logisch aufgebaut, gut nutzbar und ergonomisch gestaltet sein.
• Gestalterische Klarheit
Ein durchdachtes Design schafft Orientierung, Ruhe und visuelle Qualität.
• Emotionale Wirkung
Räume beeinflussen Verhalten, Stimmung und Wohlbefinden – bewusst und unbewusst.
• Identitätsbildung
Innenarchitektur transportiert Werte, Marken und kulturelle Botschaften.
• Nachhaltigkeit und Langlebigkeit
Materialwahl, Flexibilität und ressourcenschonende Konzepte sichern langfristige Qualität.
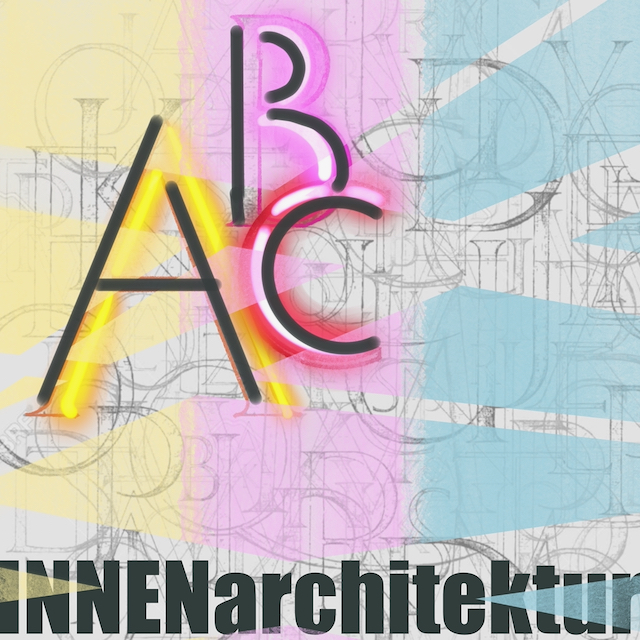
Falls Sie noch in weiteren Stichworten des Themenfeldes Innenarchitektur stöbern möchten, empfehle ich Ihnen mein Glossar: Das ABC der Innenarchitektur
Prozesse und Leistungen der Innenarchitektur
Die Prozesse und Leistungen können anhand der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) gut dargestellt werden. Dort werden die Leistungen in 9 Leistungsphasen gegliedert, die den Planungs- und Bauprozess gliedern. Die Vergütung richtet sich nach den Faktoren der Baukosten, des Schwierigkeitsgrads und des Leistungsumfangs.
HOAI
https://www.ibau.de/akademie/glossar/hoai/#
Zweck der HOAI
Die HOAI soll die Berufsgruppen der Architekt:innen und Bauingenieur:innen vor einem Preiskampf schützen und die Qualität der Arbeit in diesen Bereichen sichern. Auf der einen Seite soll den Architekt:innen und Ingenieur:innen ein auskömmliches Honorar gewährleistet werden, auf der anderen Seite den Bauherr:innen die Qualität der Leistungen. Wettbewerb soll allein durch Qualität stattfinden, nicht auf Preisebene.
Die HOAI regelt nicht die Art der Leistungen, die Architekt:innen bzw. Ingenieur:innen zu erbringen haben.
Leistungsphasen 1 – 9 und eine neue ist aktuell dazugekommen 0
1. LPH 1: Grundlagenermittlung
- Klärung der Aufgabenstellung mit dem Auftraggeber
- Analyse der Rahmenbedingungen (baulich, funktional, rechtlich)
- Erste Gespräche mit Nutzer:innen oder Betreiber:innen
- Ziel: Verstehen, was gebraucht wird – funktional und atmosphärisch
2. LPH 2: Vorplanung
- Entwicklung erster Raumkonzepte und Funktionsschemata
- Grobe Material- und Farbideen
- Erste Kostenschätzung
- Ziel: Machbarkeit prüfen und gestalterische Richtung definieren
3. LPH 3: Entwurfsplanung
- Ausarbeitung des Raumkonzepts mit Grundrissen, Ansichten, Perspektiven
- Auswahl von Materialien, Farben, Lichtkonzepten
- Integration technischer Anforderungen
- Ziel: Gestaltung konkretisieren und abstimmen
4. LPH 4: Genehmigungsplanung (bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen)
- Erstellung der erforderlichen Unterlagen für Bauanträge
- Abstimmung mit Behörden
- Ziel: Rechtssicherheit schaffen
5. LPH 5: Ausführungsplanung
- Detaillierte Pläne für die Umsetzung (Maßzeichnungen, Materiallisten)
- Koordination mit Fachplaner:innen (z. B. Haustechnik, Statik)
- Ziel: Grundlage für die handwerkliche Umsetzung schaffen
6. LPH 6: Vorbereitung der Vergabe
- Erstellung von Leistungsbeschreibungen
- Mengenermittlungen und Ausschreibungsunterlagen
- Ziel: Angebote einholen und vergleichen
7. LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe
- Prüfung und Bewertung der Angebote
- Unterstützung bei der Auftragserteilung
- Ziel: Geeignete Ausführungsfirmen auswählen
8. LPH 8: Objektüberwachung (Bauleitung)
- Kontrolle der Ausführung auf Übereinstimmung mit Planung
- Qualitäts- und Kostenkontrolle
- Koordination der Gewerke
- Ziel: Sicherstellen, dass der Raum wie geplant entsteht
9. LPH 9: Objektbetreuung
- Nachbetreuung nach Fertigstellung
- Bewertung von Mängeln, Optimierungsvorschläge
- Ziel: Nachhaltige Qualität sichern
10. oder die 0: Neu ist die Leistungsphase 0 dazu gekommen (die natürlich an den Anfang gehört!)
- Standort- und Bedarfsanalyse
- Nutzerworkshops, Stakeholder Interviews
- Entwicklung von Raumprogrammen und Nutzungskonzepten
- Budgetrahmen und Zeitplanung
- Machbarkeitsstudien
- Ziel: Projektziele definieren und damit die Grundlagen für die folgenden Planungen schaffen
Innenarchitektur ein Wirkungsfeld zwischen Wahrnehmung, Psychologie und Kreativität
Innenarchitektur ist weit mehr als Design und das Arrangieren von Möbeln und dazu eine schöne Farbe auswählen. Es ist ein komplexes Zusammenspiel aus gestalterischen Können, psychologischem Verständnis und einem hohen Maß an Empathie. Wer Räume verantwortungsvoll gestaltet, braucht ein breites Fachwissen und den Willen die Menschen wirklich verstehen zu wollen.
Die Innenarchitektur ist ein wirksames Werkzeug, das Lebensqualität schafft, Heilungsprozesse fördert und uns eine emotionale Bindung zu Räumen ermöglicht. In einer Welt, die immer komplexer und schneller wird, brauchen Menschen Orte, die Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung bieten.
Räume wirken – ob gewollt oder nicht
Jeder Raum kommuniziert mit uns. Zum allergrößten Teil in Millisekunden und absolut unbewusst. Denn bevor wir anfangen zu denken, hat unser Bewusstsein unseren Körper schon über die Gesamtwahrnehmung eines Raumes informiert. Das beeinflusst unsere Wahrnehmung, unser Gefühl und steuert unser Verhalten. Innenarchitektur kann diese Wahrnehmung bewusst gestalten und so eine positive Wirkung für uns erzielen.
Sinn und Struktur schaffen
Ganz besonders in sensiblen Bereichen, in denen Menschen verletzlich sind, wie in Einrichtungen des Gesundheitswesens, ist Innenarchitektur therapeutisch wirksam. Sie unterstützt Heilung und Regeneration, Vertrauen und Sicherheit, Orientierung und Selbständigkeit, Wohlbefinden und Zufriedenheit.
Nachhaltigkeit beginnt im Inneren
Die Räume, die auch langfristig gedacht werden, dabei eine gewisse Flexibilität haben und eine hohe Aufenthaltsqualität aufweisen, sind länger nutzbar. Wenn dann auch noch Materialien verwendet werden, die langlebig sind, sind die Räume auch morgen noch relevant und somit nachhaltig.

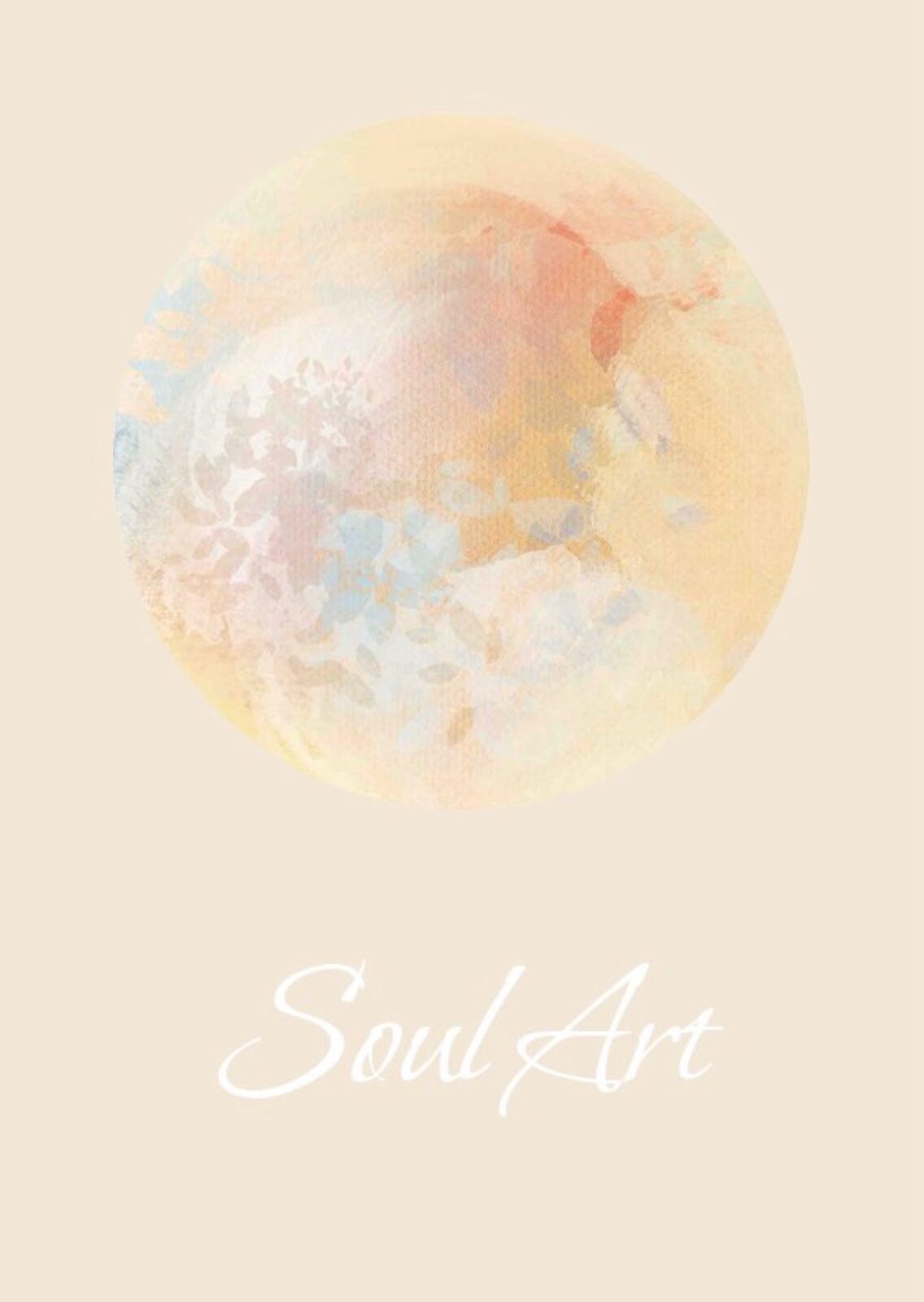

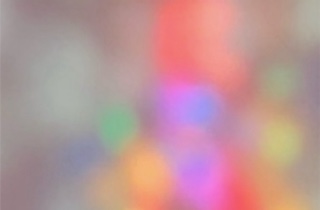


Fazit: Die Kunst, Räumen Leben zu geben
Innenarchitektur ist kein Selbstzweck und kein gestalterisches Experimentierfeld. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Räume für Menschen lebbar macht. Ihre Bedürfnisse, ihre Emotionen und ihre Lebenssituation wahrnimmt, ernst nimmt und dafür Raum entwickelt. Innenarchitektur beginnt dort, wo Gestaltung auf Empathie trifft. Wo Räume nicht nur geplant werden, sondern verstanden werden und wo Gestaltung nicht nur wirkt, sondern wirksam ist.
Als Innenarchitektin sehe ich meine Aufgabe, Räume zu entwickeln, die nicht beeindrucken, sondern berühren, die nicht nur funktionieren, sondern sich mit den Menschen verbinden.
Nutze die Wirksamkeit der Raumgestaltung
Es ist Zeit für mehr Wohlbefinden, Zufriedenheit und Erfolg – und dafür braucht es Räume, die wirken. Innenarchitektur ist eine Investition mit hohem Mehrwert. Schon kleine, gezielte Veränderungen können große Wirkung entfalten.
Ob im privaten oder beruflichen Kontext – ich unterstütze Sie mit Fachwissen, Kreativität, psychologischem Feingefühl und über 20 Jahren Erfahrung als Innenarchitektin.

Schicken Sie mir ein kurze Info, ich melde mich gerne bei Ihnen.