Mein Spezialgebiet der Innenarchitektur ist Healing Design. Und das ist besonders bei meiner Arbeit für Krankenhäuser gefragt. Lernen Sie die Herausforderungen und Lösungen bei der Gestaltung einer Intermediate-Care-Station kennen. In einem aktuellen Projekt geht es um die Gestaltung einer IMC-Station im Bestand. Was ist eine IMC-Station und was hat das Thema Delir damit zu tun? In einem Teil des Artikels beschreibe ich, wie ich das Konzept dazu entwickle, und zeige meine Vorgehensweise, wie ich so eine Aufgabe zum Ergebnis führe.
Was ist eine IMC-Station?
IMC steht für „Intermediate–Care“ – also Zwischenpflege. Eine IMC-Station ist eine spezielle Pflegeeinheit im Krankenhaus, die zwischen der Intensivstation und der Normalstation angesiedelt ist. Sie spielt eine entscheidende Rolle in der abgestuften Versorgung von Patient:innen.
Bedeutung und Funktion der IMC-Station
- Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation: Die IMC ist für Patient:innen gedacht, die eine engmaschige Überwachung benötigen, aber keine intensivmedizinische Behandlung wie künstliche Beatmung2.
- Typische Patient:innen: Menschen mit Herzrhythmusstörungen, frisch Operierte mit Blutungsrisiko oder Patient:innen mit Organversagen, deren Zustand stabil genug ist, um nicht auf der Intensivstation behandelt zu werden.
- Ausstattung und Betreuung: jeder Bettplatz ist mit Monitoren zur Überwachung von Vitalfunktionen ausgestattet (z. B. EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung), höherer Personalschlüssel als auf Normalstationen (meist 1 Pflegekraft für 3-4 Patient:innen)
Ziel einer IMC-Station
Ziel ist es, sowohl die Intensivstation als auch die Normalstation zu entlasten und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Betreuung sicherstellen.
Raumprogramm einer IMC-Station
Ein Raumprogramm für eine IMC-Station beschreibt die baulichen, funktionalen und personellen Anforderungen, die notwendig sind, um eine solche Station effizient und sicher betreiben zu können. Es ist ein zentraler Bestandteil der Krankenhausplanung und orientiert sich an medizinischen, pflegerischen und organisatorischen Standards.
Patientenzimmer
- Ein- und Zweibettzimmer mit Monitoren zur Vitalzeichenüberwachung
- Direkte Sichtverbindung zum Pflegearbeitsplatz (z. B. durch Glaswände)
- Sanitäreinheiten in jedem Zimmer oder zentral
Pflegearbeitsplatz
- Zentral gelegen mit direktem Zugang zu allen Zimmern
- Ausgestattet mit Monitoren zur zentralen Überwachung
- Dokumentationsplätze und Medikamentenschränke
Funktionsräume
- Behandlungsraum für kleinere Eingriffe oder Diagnostik
- Notfallraum mit Reanimationsausstattung
- Lagerraum für Verbrauchsmaterialien und Medizintechnik
- Technikraum für zentrale Monitoringsysteme
Personalräume
- Aufenthaltsraum für Pflegepersonal
- Umkleiden mit Sanitärbereich
- Besprechungsraum für Übergaben und Teammeetings
Besucher- und Sozialräume
- Wartebereich für Angehörige
- Gesprächszimmer für vertrauliche Gespräche
Hygiene und Reinigung
- Reinigungsraum mit Desinfektionsmöglichkeiten
- Schleusenbereiche zur Infektionsprävention
Empfehlungen zur Struktur und Ausstattung von IMC Stationen von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin:
Eine IMC Station sollte modular aufgebaut sein, um flexibel auf Patientenzahlen reagieren zu können,
einen Pflegeschlüssel von 1:3 bis 1:4 aufweisen,
eine hohe technische Ausstattung bieten, z. B. für nichtinvasive Beatmung oder Dialyse und
baulich getrennt von Intensivstationen sein, aber in deren Nähe liegen
Herausforderungen und Lösungen bei der Gestaltung einer Intermediate-Care-Station.
Themen, wichtige Aspekte und Aufgaben der Innenarchitektur, die dieser besonderen Aufgabe gerecht werden.
Sichtbeziehungen & Transparenz
- Pflegekräfte müssen alle Patientenzimmer visuell erfassen können – etwa durch Glaswände oder zentrale Monitoringsysteme.
- Gleichzeitig braucht es Privatsphäre für Patient:innen, z. B. durch Sichtschutzfolien oder Vorhänge.
Licht & Atmosphäre
- Tageslicht fördert den Heilungsprozess und reduziert Stress.
- Indirekte Beleuchtung in Nachtstunden unterstützt den zirkadianen Rhythmus.
- Farbgestaltung sollte beruhigend wirken – z. B. mit warmen Naturtönen statt steriler Weißflächen.
Akustik & Ruhe
- Geräuschreduktion ist essenziell: Schalldämpfende Materialien, leise Geräte und gute Raumakustik helfen, Stress zu minimieren.
- Trennung von lauten Funktionsbereichen (z. B. Technikräume) und Patientenzimmern.
Ergonomie & Wegeführung
- Kurze Wege zwischen Pflegearbeitsplatz, Patientenzimmern und Funktionsräumen.
- Barrierefreie Gestaltung für Patient:innen und Personal.
- Klare Zonierung: z. B. Trennung von „reinen“ und „unreinen“ Bereichen zur Infektionsprävention.
Materialwahl & Hygiene
- Oberflächen müssen leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und robust sein.
- Antimikrobielle Materialien können zusätzlich zur Infektionskontrolle beitragen.
Flexibilität & Modularität
- Räume sollten anpassbar sein – z. B. für unterschiedliche Pflegeintensitäten oder bei steigender Patientenzahl.
- Mobile Trennwände oder modulare Möblierung ermöglichen schnelle Umstrukturierungen.

Bedeutung von Healing Design
Ein Spezialgebiet der Innenarchitektur ist Healing Design. Die Raumgestaltung ist nicht nur funktional, trägt zum Heilungsprozess bei und hat eine therapeutische Wirkung. Studien zeigen, dass eine gut gestaltete Umgebung:
- die Verweildauer verkürzt
- das Stresslevel senkt
- die Patientenzufriedenheit steigt
- und die Arbeitsatmosphäre im Team verbessert
Es gibt wissenschaftlich belegte Studien zu der Wirkung von Raumgestaltung, die diese Ergebnisse belegen. Mehr dazu in meinem ausführlichen Artikel zum Thema Healing Design.
Vorgehensweise – wie geht Innenarchitektur?
Ein Einblick in meine Arbeit und wie ich bei einem solchen Projekt vorgehe. Arbeitsablauf und Entwicklungsprozess für ein Klinikprojekt.
Aufgabe
Die IMC-Station soll optimiert werden. Die Themen sind: die Verbesserungen der Abläufe, Organisationsanpassungen und optische Gestaltung mit einem Leit- und Orientierungskonzept unter dem Aspekt des Healing Designs. Aber ohne einen baulichen Eingriff. Das heißt, die Raumstrukturen bleiben so, wie sie sind.
Bedarfsanalyse
Es startet mit einem kurzen Briefing durch den Baukoordinator des Krankenhauses und Aushändigung der Planunterlagen. Dann gehen wir gemeinsam zur Station und sehen uns alles in Ruhe an: Ein paar Knackpunkte werden genannt, ich kann die Arbeitsabläufe sehen und mache mir, sehr zurückhaltend, ein Bild von den Patienten.
Mit den Informationen gehe ich erst einmal wieder zurück in mein Büro und erarbeite mir die Grundlagen zum Thema.
Vor-Ort-Gespräche mit der Stationsleitung und den Mitarbeitern
Das ist einer der wichtigsten Termine. Hier habe ich die Gelegenheit, direkt mit dem Verantwortlichen der Station und den Mitarbeitern zu sprechen. Denn die Perspektive und die Angaben zu den Abläufen und Arbeiten kann ich besser nicht kennenlernen. Um mir ein gutes Bild machen zu können, brauche ich Antworten auf die folgenden Fragen:
- Ablauf und Organisation
- Wie sieht ein typischer Ablauf auf der Station und im Patientenzimmer aus?
- Was ist an Ihrer Arbeit besonders herausfordernd?
- Was funktioniert von den Abläufen nicht gut?
- Möbel und Ausstattung
- Welche funktionieren gut, was nicht?
- Was würden Sie sich bei der Ausstattung anders wünschen?
- Wohlbefinden & Emotionen:
- Wo entstehen Stresssituationen – räumlich oder atmosphärisch?
- Wie könnten Rückzugsorte für Mitarbeitende oder Angehörige aussehen?
- Welche Orte wirken besonders belastend?
- Was ist für die Patienten das Wichtigste und was tut den Patienten gut?
- Orientierung und Wahrnehmung
- Was könnte die Orientierung verbessern?
- Was würde den Patienten helfen?
- Team
- Was würde das Arbeitsklima verbessern?
- Was würde das Team stärken?
- Prioritäten
- Was sind die 3 wichtigsten Punkte, die sofort umgesetzt werden sollten?
- Was ist der wichtigste Punkt für die Mitarbeiter?
- Was ist der wichtigste Punkte für die Patienten?
- Was ist der wichtigste Punkte für die Angehörigen?
Ideenentwicklung und Konzept
Mit all den Informationen gehe ich zurück in mein Büro und dannfange ich an, zu arbeiten. Ich recherchiere noch etwas zu dem Thema, lese mich ein und dann fange ich den Grundriss zu analysieren und sehe mir Knackpunkte aus meiner Perspektive an. Wenn ich die Punkte in Bezug zu den Informationen vom Team setzte, kristallisieren sich Themen heraus, die ich näher betrachten werde.
Feedback und Weiterentwicklung
In der Regel gibt es dann ein Gespräch mit der Baukoordination, der Pflegedienstleitung und der Stationsleitung zu den ersten Ideen. Ich stelle meine Konzeptvorschläge anhand von Skizzen, Zeichnungen mit Varianten und Abbildungen vor und diskutiere die Möglichkeiten und Vorschläge. Das ist eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der Aufgabe, und manchmal kommen da noch Punkte dazu, die vorher nicht so klar kommuniziert worden sind. Es ist auf jeden Fall, immer sehr konstruktiv und bringt das ganze Konzept einen großen Schritt nach vorne.
Entwurf und Detailplanung
Mit den Ergebnissen kann ich dann ins Detail gehen. Ich entwickle Lösungen für aufgezeigte Probleme in Abläufen und Nutzung, entwickle individuelle Möbel, erstelle ein Farb- und Materialkonzept, und mache mir Gedanken über die Wandgestaltung, Lichtgestaltung und Vorschläge für ein zusammenfassendes Orientierungsdesign auf der Station.
Abschlusspräsentation
Zum Schluss wird das Ergebnis vorgestellt und von allen Beteiligten wird die Freigabe für die Vorschläge eingeholt. Alles lässt sich in der Regel nicht verwirklichen und es müssen meist Kompromisse gefunden werden und Prioritäten gesetzt werden.
Umsetzungsprozess
Dann startet der Umsetzungprozess. Der Entwurf wird mit der Haustechnik abgestimmt, Gewerke bekommen die Ausführungsdetails, die Abstimmung mit der Hygiene findet statt und ein Ablaufplan wird erstellt. Diese Baustellen finden ja in der Regel im laufenden Betrieb statt, und das erfordert eine sehr sensible und detaillierte Planung. Durch diesen Umstand wird die Ereuerung in viele kleine Schritte zerlegt und dauert dementsprechend länger.
Das zentrales Thema auf der IMC: Delir
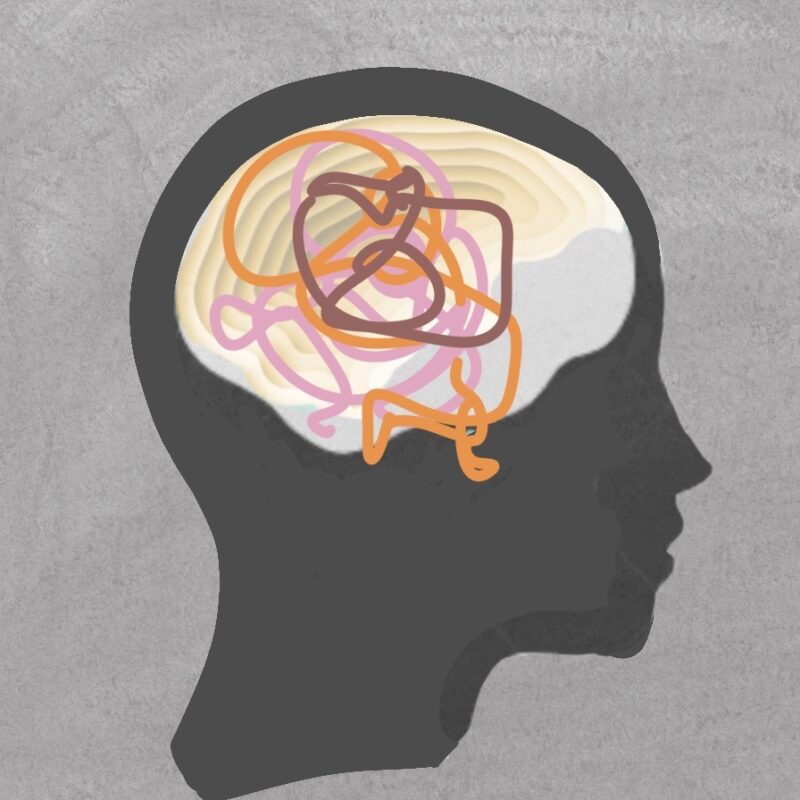
Der Hintergrund und warum das so wichitg ist
Ein Delir:
- kann die Genesung verzögern und zu längerer Liegezeit führen
- zu bleibenden kognitiven Einschränkungen führen
- die Sterblichkeit erhöhen, wenn es nicht erkannt und behandelt wird
Studien zeigen, dass bis zu 30–50 % der älteren Patient:innen auf Intensivstationen/IMC-Stationen ein Delir entwickeln. Deshalb ist die präventive Gestaltung der Umgebung ein zentraler Baustein.
Forschungsprojekt TRADE (TRAnsport und DElir bei älteren Menschen) zu Prävention und Management von Delir im Krankenhaus bei Entlassung und Verlegung. Zur Studie.
Was ist ein Delir?
Ein Delir ist ein akuter Verwirrtheitszustand, der plötzlich auftritt und meist durch eine Störung der Gehirnfunktion verursacht wird. Es handelt sich um einen medizinischen Notfall, der besonders bei älteren Menschen, nach Operationen oder bei schweren Erkrankungen häufig vorkommt.
Merkmale eines Delirs
Bewusstseinsstörungen: Die Betroffenen wirken benommen, verwirrt oder nicht ansprechbar.
Orientierungslosigkeit: Zeit, Ort und Personen können nicht mehr richtig eingeordnet werden.
Störungen des Denkens: Sprunghafte Gedanken, Halluzinationen oder Wahnvorstellungen.
Schlaf-Wach-Rhythmus gestört: Oft nachts aktiv und tagsüber schläfrig.
Starke Schwankungen: Der Zustand kann sich im Tagesverlauf stark verändern.
Ursachen
Akute körperliche Erkrankungen (z. B. Infektionen, Organversagen)
Medikamente (z. B. Schmerzmittel, Psychopharmaka)
Operationen und Narkosen
Flüssigkeitsmangel, Fieber, Schmerzen
Veränderung der Umgebung (z. B. Krankenhausaufnahme, Umzug)
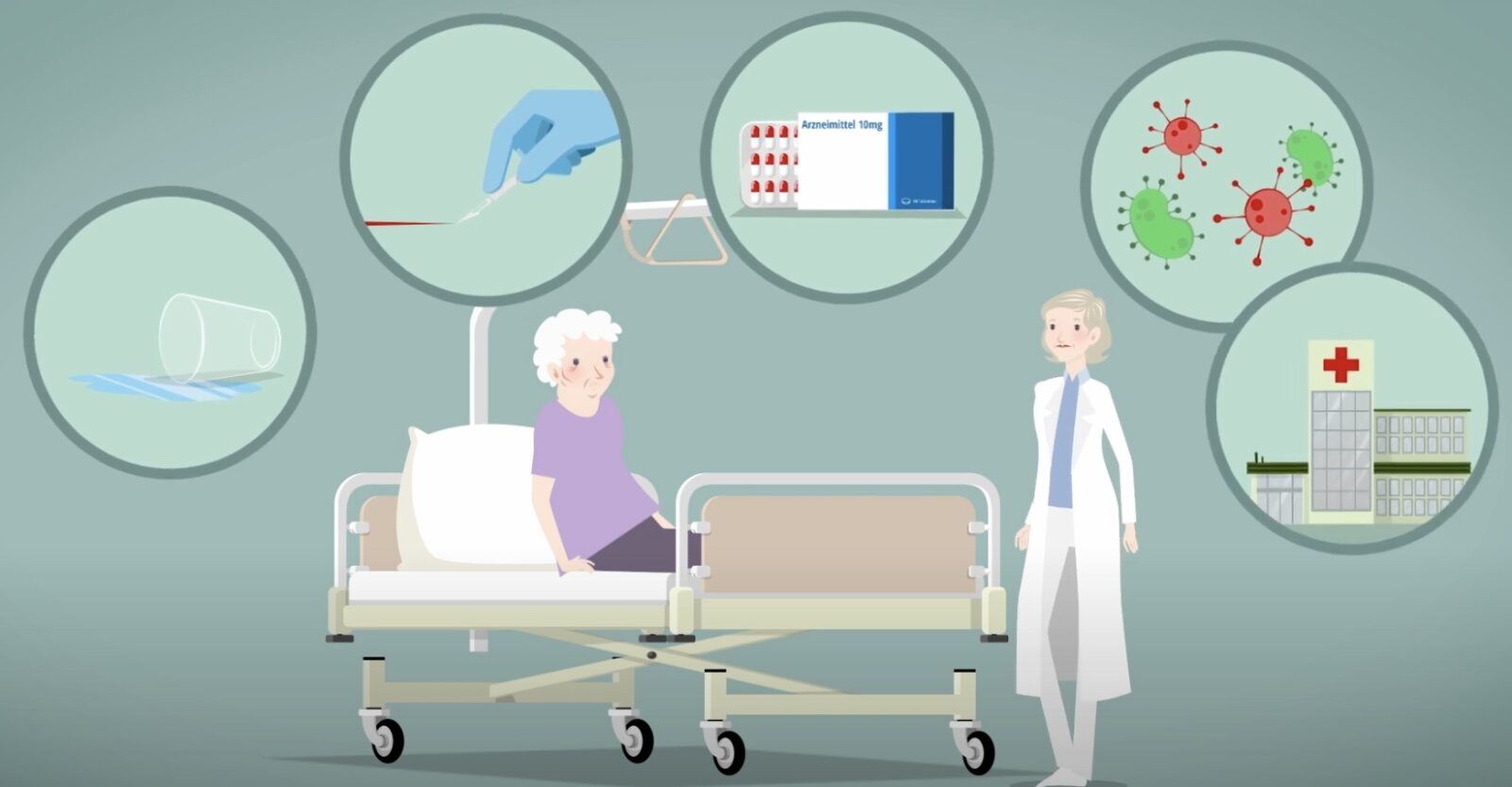
Delir-Vorbeugung bei älteren pflegebedürftigen Menschen | ZQP-Erklärfilm
Wie lässt sich eine Delir verhindern oder lindern?
Kompetenz des Gesundheitspersonals stärken: Schulung zu Krankheitsbild, Risikofaktoren und Screeningmethoden, Anwendung evidenzbasierter Präventions- und Interventionsstrategien.
Frühzeitige Erkennung durch Routinescreenings: Regelmäßige Anwendung von Screening-Instrumenten (z. B. CAM, DOS), Beobachtung durch Pflege, Angehörige und ärztliches Personal.
Ärztliche Diagnostik & Differenzierung: Klinische Untersuchung, Anamnese, Labor, EKG und Abgrenzung zu Demenz und Depression durch Differentialdiagnostik.
Multiprofessioneller & multimodaler Ansatz: Zusammenarbeit von Pflege, Medizin, Therapie, Sozialdienst. Maßnahmen wie: Behandlung körperlicher Ursachen, Flüssigkeits- und Nahrungsversorgung, Reizreduktion und ruhige Umgebung, Mobilisation und Reorientierung, Stabilisierung des Tag-Nacht-Rhythmus.
Einbindung von Angehörigen: Vermittlung von Vertrautheit und Sicherheit, Unterstützung bei Orientierung und Kommunikation, Aufklärung über Delir und Mitwirkung bei Früherkennung
Mehr zum Themengebiet und zu wissenschaftlichen Studien gibt es bei der Forschungsdatenbank der Stiftung ZQP (Zentrum für Qualität in der Pflege)
Delir-sensitive Raumgestaltung
Die DIVI-Empfehlungen (Deutsche interdisziplinäre Vereinigung der Intensiv- und Notfallmedizin) zur Gestaltung von Stationen und Patientenzimmern betonen ebenfalls die Bedeutung von baulichen und gestalterischen Maßnahmen zur Delirprävention. Welche Punkte sollte die Innenarchitektur bei der Umgebungsgestaltung berücksichtigen?
Grundstruktur & Zonierung
- Symmetrische Raumaufteilung mit klarer Trennung der beiden Bettbereiche
- Individuelle Licht- und Temperatursteuerung pro Bettseite
- Direkte Sichtverbindung zum Pflegearbeitsplatz durch Glasfront mit Sichtschutzoption
Lichtgestaltung
- Tageslichtzugang durch große Fenster mit Blick ins Freie
- Zirkadiane Lichtsteuerung: LED-Systeme simulieren Tagesverlauf (Sonnenaufgang bis Abenddämmerung)
- Indirekte Nachtbeleuchtung zur Orientierung ohne Reizüberflutung
Akustik & Ruhe
- Schalldämpfende Wand- und Deckenmaterialien
- Geräuscharme Medizintechnik (z. B. leise Infusionspumpen, visuelle Alarme)
- Trennung von Technik- und Ruhezone im Raumlayout
Orientierung & Reizkontrolle
- Große, analoge Uhr und Kalender gut sichtbar vom Bett aus
- Farbliche Zonierung: z. B. warme Töne für Ruhebereiche, kontrastreiche Farben für Orientierungspunkte
- Beschilderung mit Symbolen und Text zur besseren Erkennung
Personalisierung & Kontrolle
- Raum für persönliche Gegenstände (Fotos, Decke, Musik)
- Individuell steuerbare Raumfunktionen: Licht, Jalousien, Musik
- Privatsphäre durch Vorhänge oder mobile Trennwände zwischen den Bettbereichen
Mobilität & Sicherheit
- Haltegriffe entlang der Gehwege
- Rutschfester Bodenbelag mit Orientierungslinien
- Sitzmöglichkeiten am Fenster zur Aktivierung und Reorientierung
Pflegeintegration
- Pflegearbeitsplatz in Sichtweite, aber akustisch entkoppelt
- Zentrale Monitoringsysteme mit visuellem Alarmmanagement
- Materiallager und Dokumentationsplatz direkt angrenzend, ohne den Ruhebereich zu stören
Technik & Hygiene
- Flächenbündige Installationen zur leichten Reinigung
- Antimikrobielle Oberflächenmaterialien
- Lüftungssystem mit kontrollierter Luftführung zur Infektionsprävention
Zusatz: Delirpräventive Elemente
- Aromadiffusor mit beruhigenden Düften (z. B. Lavendel, Melisse)
- Musikmodul mit individuell wählbaren Klängen
- Tagesstruktur-Display mit Uhrzeit, Mahlzeiten, Besuchszeiten
Erkenntnis
Mir war zu Beginn nicht klar, dass das Thema Delir so eine Bedeutung für die Intensiv- und Intermediate-Care-Stationen hat. Ich habe viel zu dem Thema gelernt. Letztendlich bestimmt dieses Thema das Gestaltungskonzept für die Station. Doch die Gestaltung, die so entsteht, ist für alle Nutzer der Station sinnvoll und hilfreich. Aufklärung zum Thema Delir ist notwendig und sinnvoll. Ich kann mich erinnern, dass ich bei einem Krankenbesuch, die Delir-Situation erlebt habe und ziemlich irritiert war. Ich konnte das damals nicht einordnen und ich kann mich auch nicht an einen Hinweis vom Personal erinnern, der mir dazu eine Erklärung gegeben hat.
Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass es auch für diese besonderen Themen Lösungsansätze gibt. Das Wissen und die Forschung zum Thema Healing Design können auch dort Unterstützung für den Heilungsprozess und das Wohlbefinden der Patienten, Angehörigen und Mitarbeiter leisten.
Sie haben auch ein besonderes Thema?
Innenarchitektur lohnt sich – immer.

Rufen Sie mich gerne an und wir finden heraus, was wir für Ihre Räume erreichen können.
Ihre Innenarchitektin für die Wirksamkeit der Raumgestaltung.
Einen ausführlicher Projektbericht über die Gestaltung von Patientenzimmern im Wahlleistungsbereich finden Sie hier: Healing Design – vom Krankenhaus zu einem Haus zum Gesunden